Zukunftsenergien
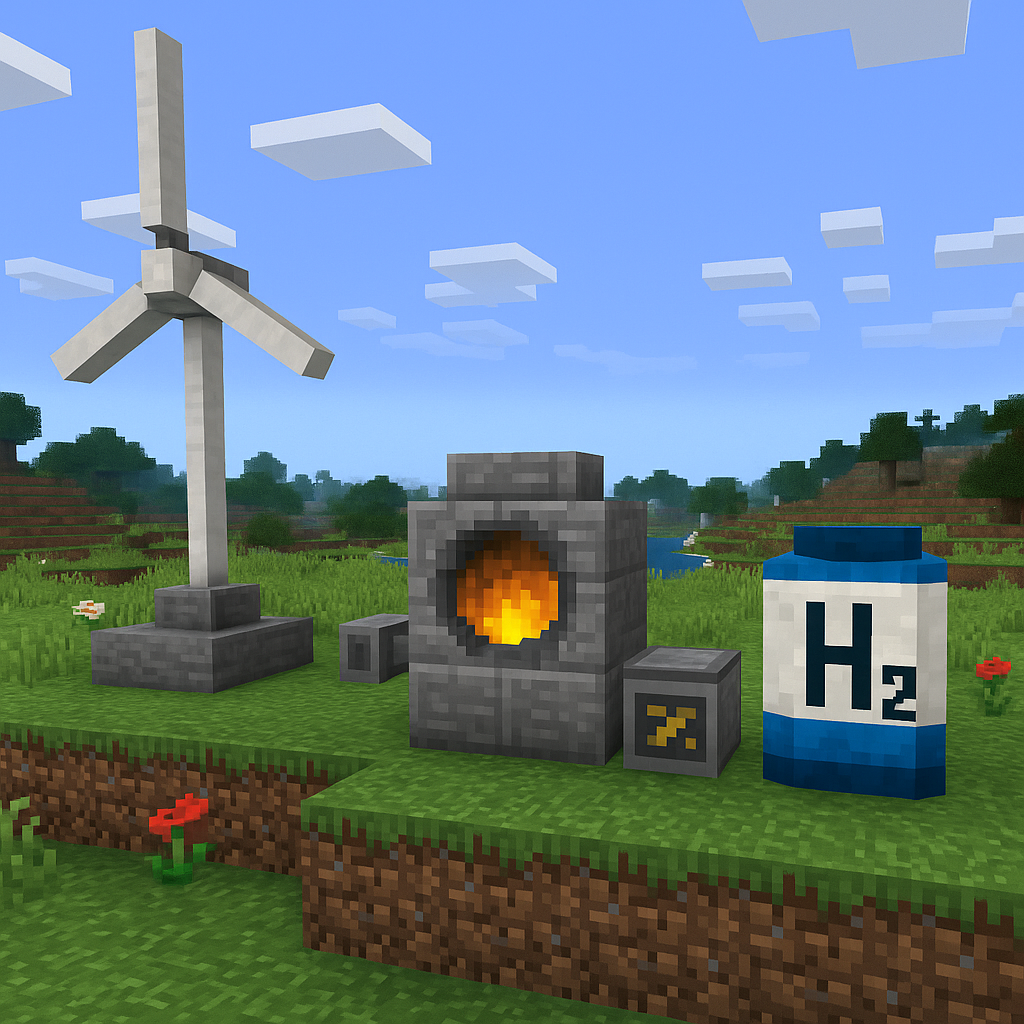
Im Folgenden werden fünf Themenbereiche des Wissenschaftsjahres kurz vorgestellt.
- In einem Absatz
- In Einfacher Sprache
- Auf zwei Seiten
- Beispielaufgabe für den Wettbewerb
“Ein weltweit steigender Energiebedarf, begrenzte Ressourcen und der Klimawandel stellen Regierungen und Industrie, aber auch Bürgerinnen und Bürger vor neue Herausforderungen. Sie geben Anlass, schon heute über die Energieversorgung von morgen nachzudenken …
Wie können wir durch erneuerbare Energien, Energiespeicher und neue Technologien eine versorgungssichere, kosteneffiziente und nachhaltige Energieversorgung aufbauen? Welche Technologien nutzen wir dazu schon heute und was erwartet uns in Zukunft?” (https://www.wissenschaftsjahr.de/2025/)
Im Folgenden werden konkrete Beispiele für mögliche Zukunftsenergien vorgestellt. Nach einem ausführlicheren Text gibt es jeweils eine kurze Zusammenfassung und Beispiele für Umsetzungsaufgaben in den Games.
Fusionsenergie könnte in Zukunft viel saubere Energie aus wenig Brennstoff liefern – ganz ohne CO₂-Ausstoß und ohne Risiko einer gefährlichen Kettenreaktion. In der Sonne entsteht Energie, indem Wasserstoff unter extremem Druck und hoher Temperatur zu Helium verschmilzt – das versuchen Forschende auch auf der Erde nachzumachen. Zwei Ansätze stehen im Mittelpunkt: 1) die Magnetfusion, bei der heißes Plasma durch Magnetfelder eingeschlossen wird, und 2) die Laserfusion, bei der ein Brennstoffkügelchen mit Lasern stark komprimiert wird. Deutschland gehört bei der Magnetfusion zur Weltspitze und fördert mit dem Programm „Fusion 2040“ die Forschung für ein zukünftiges Fusionskraftwerk.
Fusionsenergie könnte in Zukunft eine tolle Sache sein. Sie ist ressourcenschonend, das heißt, wir brauchen nur wenig Brennstoff. Sie ist sauber, weil keine schädlichen Abgase entstehen. Sie ist sicher, weil es keine gefährlichen Kettenreaktionen geben kann. Und sie kann immer Strom liefern, also auch dann, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Mit Fusionsenergie könnte man aus kleinen Mengen Brennstoff sehr viel Energie gewinnen.
Aber: Bis das wirklich funktioniert, ist noch viel Forschung nötig. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) hilft dabei mit einem speziellen Programm namens „Fusion 2040 – Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“. Dieses Programm unterstützt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an der Entwicklung der Fusionsenergie arbeiten.
Was ist Fusion eigentlich?
Fusion ist das, was in der Sonne und anderen Sternen passiert. Dort verschmelzen die Kerne von Wasserstoffatomen zu Heliumkernen. Dabei wird ein bisschen Masse in Energie umgewandelt.
Damit diese Verschmelzung klappt, braucht es sehr viel Druck und sehr hohe Temperaturen. Warum? Weil die Wasserstoffkerne sich normalerweise abstoßen wie die gleichnamigen Pole zweier Magnete. Nur wenn sie sehr stark zusammengepresst und erhitzt werden, können sie sich verbinden. In der Sonne zum Beispiel herrschen bis zu 15 Millionen Grad Celsius und riesige Drücke.
Wie wollen wir das auf der Erde schaffen?
Forscher auf der ganzen Welt versuchen, Bedingungen, unter denen Fusion funktionieren kann, auf der Erde nachzubauen. So wollen sie die Energie der Fusion für uns nutzbar machen. Es gibt zwei Ansätze:
- Magnetfusion: Hier wird ein spezielles Gas aus Wasserstoff sehr stark erhitzt, sodass es zu einem Plasma wird. Plasma ist wie ein sehr heißer, elektrisch geladener Zustand des Gases. Dieses Plasma darf nicht die Wände des Reaktors berühren, weil es sonst abkühlen würde und keine Fusion mehr stattfinden könnte. Deshalb wird das Plasma in starken Magnetfeldern eingeschlossen. Bei gut 100 Millionen Grad Celsius können Fusionsreaktionen stattfinden. Es gibt zwei Arten von Magnetfusionsreaktoren: den Tokamak und den Stellarator. Der Stellarator hat eine kompliziertere, verdrehte Form, die eigentlich besser ist, aber er ist schwieriger und teurer zu bauen und zu warten. Die Magnetfusion ist die Methode, die im Moment am besten erforscht ist.
- Laserfusion: Hier wird ein kleines Kügelchen mit Brennstoff (das Target) mit starken Laserstrahlen beschossen und sehr schnell und stark zusammengepresst. Dadurch wird es so heiß und dicht, dass die Fusion starten kann. Nach dem Zusammenpressen dehnt sich das heiße Material sehr schnell wieder aus – idealerweise aber langsam genug, dass Fusion stattfinden kann. Auch bei der Laserfusion gibt es verschiedene Methoden, je nachdem, ob die Laser direkt auf das Kügelchen zielen oder es indirekt über einen Umweg treffen.
Warum ist Fusionsenergie so interessant?
Fusionsenergie hätte viele Vorteile:
- Weniger Rohstoffe: Man braucht nur wenig Brennstoff. Ein Gramm Fusionsbrennstoff kann so viel Energie liefern elf bis dreizehn Tonnen Kohle.
- Sauber: Es entstehen keine schädlichen Abgase wie beim Verbrennen von Kohle oder Öl. Der Strom wäre CO2-neutral.
- Sicher: Es kann keine unkontrollierte Kettenreaktion geben, wie in einem Atomkraftwerk. Wenn etwas schiefgeht, stoppt die Reaktion sofort.
Was muss noch getan werden?
Damit Fusionskraftwerke Realität werden, ist noch viel Forschung nötig. Ein wichtiges internationales Projekt ist ITER in Frankreich, an dem Deutschland beteiligt ist. Deutschland gehört dank vieler Jahre Forschung zu den führenden Ländern im Bereich Fusion, besonders bei der Magnetfusion. Auch bei der Laserfusion verfügt Deutschland über wichtiges Wissen, zum Beispiel bei Lasern.
Um in der Forschung weiter vorne zu bleiben, hat das BMFTR das Programm „Fusion 2040“ gestartet. Ziel ist es, wichtige Teile für zukünftige Fusionskraftwerke zu entwickeln. Dabei werden beide Methoden (Magnet- und Laserfusion) unterstützt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Firmen sollen zusammenarbeiten. So soll ein Netzwerk entstehen, das hilft, die Fusion von der Forschung in die Anwendung zu bringen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Regeln für Fusionskraftwerke. Das BMFTR fördert deshalb ein Projekt namens „Pilotvorhaben zur Regulatorik für Fusionsanlagen“ (ReFus), um die wissenschaftlichen Grundlagen künftiger Regeln zu erforschen.
Fusionsenergie ist potenziell ressourcenschonend, sauber, sicher und grundlastfähig. Perspektivisch lassen sich damit große Mengen Energie aus kleinen Mengen Brennstoff gewinnen. Doch bis dahin ist noch viel Forschung notwendig. Zusätzlich zur jahrzehntelangen institutionellen Förderung unterstützt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) diese Forschung mit dem Förderprogramm „Fusion 2040 – Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“.
Fusion ist die Energiequelle der Sonne. In ihr verschmelzen Wasserstoffatome zu Heliumatomen. Die Masse der so entstehenden Kerne ist geringer als diejenige der ursprünglichen Kerne. Die Differenz wird als Energie freigesetzt.
Dieser Prozess ist nur unter hohem Druck und hoher Temperatur möglich, weil die gegenseitige Abstoßung der positiv geladenen Atomkerne sonst ihre Fusion verhindern würde. Im Inneren der Sonne beispielsweise herrschen bis zu 15 Millionen Grad Celsius und ein Druck von 100 Millionen Bar.
Fusionsreaktoren – Die Kraft der Sonne auf Erden
Weltweit versuchen Forscherinnen und Forscher auch auf der Erde Bedingungen zu schaffen, die Fusion ermöglichen – und ihre Energie so für uns nutzbar zu machen. Derzeit finden zwei technologische Ansätze besondere Beachtung: die Magnet- und die Laserfusion. Bei der Magnetfusion wird innerhalb eines Gefäßes ein Gasgemisch aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium so stark erhitzt, dass ein Plasma entsteht. Wenn dieses Plasma auf die Gefäßwand treffen würde, würde es sich sofort abkühlen. Eine Fusionsreaktion wäre damit nicht mehr möglich. Mithilfe von Magnetfeldern lässt sich das Plasma jedoch im Gefäß einschließen, da die vorliegenden Protonen und Elektronen den Magnetfeldlinien folgen. Dadurch reduziert sich der Kontakt mit der Reaktorwand. Im Plasma können dann – ähnlich wie in der Sonne – Fusionsreaktionen stattfinden.
Der Tokamak und der Stellarator sind die zwei gängigsten Varianten eines Magnetfusionsreaktors. Beim Stellarator ist die Donut-artige Form im Gegensatz zum Tokamak aufgrund der unterschiedlichen Magnetfeldkonfigurationen zusätzlich in sich gewunden. Prinzipiell bringt diese Form entscheidende Vorteile mit sich. Allerdings sind die Bauteile eines Stellarators viel komplexer sowie sein Bau und seine Wartung komplizierter und kostspieliger. Die Magnetfusion ist zurzeit der Ansatz, der am weitesten erforscht ist.
Bei der Laserfusion wird ein Brennstoffkügelchen („Target“) mittels Laserstrahlen schnell und stark zusammengedrückt, sodass die hohen Temperaturen und Dichten für die Fusionsreaktion erreicht werden können. Nach der Komprimierung breitet sich das
Brennstoffplasma aus. Da es aufgrund der Trägheit aber nicht unendlich schnell auseinanderfliegen kann, können währenddessen Fusionsreaktionen stattfinden. Auch innerhalb der Laserfusion gibt es verschiedene Verfahren. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen dem „direct drive“ und „indirect drive“. Der wesentliche Unterschied besteht darin, ob die Laserstrahlen direkt auf das Brennstoffkügelchen gerichtet sind oder ob sie den Brennstoff über einen Umweg – also indirekt – zur Kompression bringen.
Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk
Fusionsenergie wäre potentiell ressourcenschonend, sauber, sicher und grundlastfähig. Ein Gramm Fusionsbrennstoff kann etwa die gleiche Menge Energie wie elf bis 13 Tonnen Steinkohle freisetzen. Zudem werden keine fossilen Brennstoffe verbrannt. Der produzierte Strom wäre somit CO2-neutral. Gefährliche, unkontrollierte Kettenreaktionen sind physikalisch unmöglich. Ein Betriebsausfall würde die Reaktion unmittelbar stoppen.
Um Fusionsenergie in die Anwendung zu bringen, ist weitere Forschung unbedingt notwendig. Internationale Beachtung findet vor allem das internationale Forschungsprojekt ITER „International Thermonuclear Experimental Reactor“ im südfranzösischen Cadarache, an dem Deutschland über Euratom beteiligt ist. Deutschland zählt dank langjähriger institutioneller Förderung zu den weltweit führenden Nationen im Bereich der Fusionsforschung, insbesondere in der Magnetfusion. Mit Blick auf die Laserfusion verfügt Deutschland über wichtige Teiltechnologien, beispielsweise zu Lasern und Optik.
Um den Spitzenplatz in der Fusionsforschung zu halten und auszubauen, hat das BMFTR das Förderprogramm „Fusion 2040 – Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“ ins Leben gerufen. Ziel ist projektbasierte Forschung, die zum technologischen Reifegrad wesentlicher Komponenten eines zukünftigen Fusionskraftwerks beitragen soll. Diese Forschung erfolgt technologieoffen, unterstützt also sowohl die Magnet- als auch die Laserfusion. Zudem ist das Programm als technologieorientierte Verbundforschung angelegt, um Wissenschaft und Industrie zusammenzubringen. Auf diese Weise und über BMFTR-geförderte Nachwuchsgruppen entsteht ein Fusionsökosystem, das nötig ist, damit die Fusion den Sprung von der Forschung in die Anwendung schafft.
In einem weiteren wesentlichen Schritt müssen rechtliche Rahmenbedingungen für Fusionskraftwerke geschaffen werden. Mit dem „Pilotvorhaben zur Regulatorik für Fusionsanlagen“ (ReFus) unterstützt das BMFTR die Erforschung diesbezüglicher wissenschaftlicher Grundlagen.
Eine konkrete Aufgabenstellung für Jugendliche könnte sein:
“Baue eine Anlage, die Fusionsenergie erzeugt oder nutzbar macht. Suche Dir eine der Technologien aus und setze diese im Spiel erkennbar um. Beschreibe im Video oder durch Texttafeln, was bei der Nutzung der Fusionsenergie beachtet werden muss. Überlege wie man Fusionsenergie in einem Energiesystem einbinden kann.”
Grüner Wasserstoff ist wichtig für die Energiewende, weil er ohne CO₂-Emissionen hergestellt wird und fossile Energieträger ersetzen kann. Vor allem in der Industrie und im Verkehr, wo Strom nicht immer direkt nutzbar ist, bietet er große Vorteile – etwa bei der Stahlherstellung, im Schwerlastverkehr oder im Flug- und Schiffsverkehr. Deutschland setzt deshalb auf Forschung: Mit den Wasserstoff-Leitprojekten H2Giga, H2Mare und TransHyDE wird daran gearbeitet, Elektrolyseure in Serie zu produzieren, Wasserstoff auf hoher See zu erzeugen und Transport sowie Speicherung zu verbessern. So stärkt Grüner Wasserstoff Klima, Wirtschaft und Versorgungssicherheit.
Wasserstoff kann etwas Besonderes. Man kann mit ihm Strom speichern und transportieren. Er kann in vielen Bereichen genutzt werden. Außerdem ist er wichtig für Fabriken, die chemische Produkte herstellen.
Heute wird Wasserstoff fast nur aus Erdgas gemacht. Das ist aber nicht gut für das Klima. In Zukunft soll die Industrie Grünen Wasserstoff nutzen. Auch für Autos und andere Fahrzeuge könnte Wasserstoff wichtig werden. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unterstützt seit 2020 Projekte, die helfen sollen, Wasserstoff besser zu nutzen.
Was ist Grüner Wasserstoff?
Wasserstoff ist ein Gas, das man nicht sehen kann. Aber je nachdem, wie der Wasserstoff hergestellt wird, trägt er verschiedene „Farben“ im Namen.
Grüner Wasserstoff wird mit Strom aus erneuerbaren Energien (wie Sonne und Wind) und Wasser gemacht. Bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff entsteht kein schädliches CO₂ (Kohlenstoffdioxid).
Der Wasserstoff, der heute am meisten genutzt wird, wird meistens aus Erdgas gemacht (Grauer Wasserstoff). Dabei entsteht sehr viel CO₂, das in die Luft gelangt. Deshalb brauchen wir für die Zukunft Grünen Wasserstoff, der gut für das Klima ist.
Was kann Grüner Wasserstoff leisten?
Die Herstellung von Wasserstoff braucht viel Energie. Deshalb ist es am besten, wenn man grünen Strom direkt nutzen kann, ohne ihn erst in Wasserstoff umzuwandeln. Aber Grüner Wasserstoff ist besonders nützlich in Bereichen, die man nicht so einfach mit Strom betreiben kann – zum Beispiel in Fabriken und für manche Fahrzeuge wie schwere LKW.
Viele Fabriken, besonders Stahlwerke und Chemiebetriebe, können nur mit klimafreundlichem Wasserstoff umweltfreundlicher werden. Bei der Stahlherstellung könnte Wasserstoff die Kohle ersetzen, die heute in der Erzeugung genutzt wird. Wenn diese Fabriken von Grauem auf Grünen Wasserstoff umsteigen, könnte man in Zukunft sehr viel CO₂ sparen.
Auch für Fahrzeuge ist Grüner Wasserstoff nützlich, besonders dort, wo normale Elektroautos in absehbarer Zeit nicht funktionieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, Grünen Wasserstoff zu nutzen:
- Brennstoffzellen: Sie machen aus Wasserstoff Strom, der dann einen Elektromotor antreibt. Das ist besonders gut für große Lastwagen, Busse und Züge.
- Wasserstoff-basierte E-Fuels: Das sind künstliche Kraftstoffe, die wie Benzin, Diesel und Kerosin in normalen Motoren verwendet werden können. Flugzeuge, Schiffe und ein Teil der Lastwagen werden in Zukunft wahrscheinlich nur mit E-Fuels funktionieren.
Grüner Wasserstoff kann aber auch helfen, unser Stromnetz stabiler zu machen. Strom aus erneuerbaren Energien ist abhängig vom Wetter. Wasserstoffkraftwerke könnten zum Beispiel dann Strom liefern, wenn viel Strom gebraucht wird, aber gerade keine Sonne scheint oder kein Wind weht.. Das wäre eine Art großer Speicher.
Wie wird die Forschung zu Grünem Wasserstoff gefördert?
Die deutsche Regierung hat 2020 einen Plan gemacht, die Nationale Wasserstoffstrategie. Damit soll alles rund um Wasserstoff in Deutschland gestärkt werden. Seitdem hat Deutschland viel in die Forschung und Entwicklung von Wasserstoff-Technologien investiert. Auch der Aufbau einer Infrastruktur für Grünen Wasserstoff wird vorangetrieben (z.B. der Bau von Speichern und Leitungen für den Transport). Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, denn Deutschland wird nicht genug Grünen Wasserstoff selbst herstellen können. Der größte Teil soll im Ausland mit deutscher Technologie produziert und nach Deutschland gebracht werden.
Das BMFTR fördert neben vielen kleineren Projekten drei große Forschungsprojekte zum Thema Wasserstoff:
- H2Giga: Hier wird daran gearbeitet, wie man Geräte zur Wasserstoffherstellung (Elektrolyseure) in großer Stückzahl produzieren kann. Heute werden diese Geräte meistens von Hand gebaut. Eine Serienproduktion würde sie billiger und schneller verfügbar machen.
- H2Mare: Dieses Projekt erforscht, wie man Grünen Wasserstoff und andere Produkte, die mit grünem Strom hergestellt werden (Power-to-X), auf See produzieren kann. Dort gibt es viel Windkraft, die man direkt nutzen könnte, ohne den Umweg über das Stromnetz.
- TransHyDE: Weil Wasserstoff ganz besondere Eigenschaften hat, kann er nicht genauso transportiert werden wie Erdgas. Bei TransHyDE geht es deshalb um den Transport und die Lagerung von Wasserstoff. Es werden neue Lösungen entwickelt und getestet, zum Beispiel der Transport durch normale Gasleitungen, in speziellen Behältern oder in Verbindung mit anderen Stoffen.
Warum ist Grüner Wasserstoff so wichtig?
Grüner Wasserstoff ist sehr wichtig für die Energiewende. Er ist ein sauberer Energieträger und hilft, weniger CO₂ auszustoßen. So können wir das Klima schützen. Außerdem kann Grüner Wasserstoff in vielen Bereichen die alten, umweltschädlichen Energieträger Kohle, Öl und Erdgas ersetzen. Das könnte langfristig sogar die Energiekosten senken. Und nicht zuletzt schafft die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft neue Arbeitsplätze und Geschäftsideen, was auch der Wirtschaft hilft.
In Wasserstoff lässt sich elektrische Energie speichern, transportieren und in verschiedenen Sektoren nutzen. Außerdem ist er ein wichtiger Grundstoff für chemische Prozesse in der Industrie. Heute wird Wasserstoff nahezu ausschließlich aus fossilem Erdgas hergestellt. Zukünftig soll die Industrie auf klimafreundlichen Grünen Wasserstoff umstellen. Auch im Verkehr wird Wasserstoff eine Rolle spielen. Das BMFTR unterstützt seit 2020 mehrere Forschungsprojekte, um Hürden in der Wasserstoffwirtschaft abzubauen.
Wasserstoff ist ein farbloses Gas. Je nach Art der Erzeugung trägt er jedoch verschiedene Farben in seinem Namen. Grüner Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse von Wasser unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff entstehen deshalb keine CO2-Emissionen. Der derzeit am häufigsten verwendete Graue Wasserstoff hingegen wird meist aus fossilem Erdgas hergestellt. Dabei entstehen rund 10 Tonnen CO₂ pro Tonne Wasserstoff, die in die Atmosphäre abgegeben werden. Das nachhaltige Energiesystem der Zukunft braucht daher klimafreundlichen Grünen Wasserstoff.
Mehr zum Thema finden Sie bei den Wasserstoff-Leitprojekten:
Wissenswertes zu Wasserstoff, inkl. Farbenlehre
Die Potenziale von Grünem Wasserstoff
Die Produktion von Wasserstoff ist sehr energieintensiv. Deshalb gilt: Wenn der grüne Strom ohne Umweg direkt nutzbar ist, ist dies die ressourcenschonendste Option. Der Einsatz von Grünem Wasserstoff ist vor allem in den Bereichen sinnvoll, die sich nur schwer elektrifizieren lassen – zum Beispiel in der Industrie und in Teilen des Verkehrs.
Viele Industrie-Prozesse lassen sich nur durch den Einsatz von klimafreundlichem Wasserstoff nachhaltig gestalten, vor allem in der Stahl- und Chemieindustrie. Bei der Stahlherstellung kann Wasserstoff die heute eingesetzte Kohle vollständig ersetzen. Stellt die Industrie von Grauem auf Grünen Wasserstoff um, können dadurch künftig riesige Mengen CO2 eingespart werden.
Im Verkehrssektor ist Grüner Wasserstoff überall dort sinnvoll, wo der Antrieb mit Strom in absehbarer Zeit nicht funktionieren wird. Dabei sind zwei Einsatzmöglichkeiten für Grünen Wasserstoff denkbar: Zum einen gibt es Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff einen Elektromotor antreiben. Diese Technik eignet sich insbesondere im Schwerlastverkehr sowie für Busse und Bahnen. Zum anderen gibt es wasserstoff-basierte E-Fuels, die wie Benzin, Diesel und Kerosin in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen können. Insbesondere der Flug- und Schiffsverkehr sowie Teile des Schwerlastverkehrs funktionieren langfristig nur mit E-Fuels.
Letztlich kann Wasserstoff künftig aber auch im Stromsektor dazu beitragen, die
Widerstandskraft des Stromnetzes der Zukunft zu erhöhen. Wasserstoffkraftwerke haben beispielsweise das Potenzial, bei hoher Stromnachfrage und geringem Angebot von Strom aus erneuerbaren Energien eine Ausgleichfunktion zu übernehmen, wenn effizientere Flexibilitätsoptionen oder Speicher nicht ausreichen.
Förderung der Forschung zu Grünem Wasserstoff
Im Jahr 2020 verabschiedete die Bundesregierung die Nationale Wasserstoffstrategie, um die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu stärken. Seither machte Deutschland erhebliche Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung von Wasserstoff-Technologien sowie der Errichtung einer Infrastruktur für Grünen Wasserstoff. Dazu zählt insbesondere auch der Aufbau von globalen Energiepartnerschaften, denn Deutschland selbst wird nicht ausreichend Grünen Wasserstoff produzieren können. Der Großteil soll im Ausland mit Technologie made in germany produziert und importiert werden.
Um Deutschland den Weg zur Wasserstoff-Republik zu ebnen, fördert das BMFTR neben vielen kleineren Forschungsprojekten derzeit drei große Wasserstoff-Leitprojekte:
- In H2Giga arbeiten Forschende daran, die Produktion von Elektrolyseuren aufs Fließband zu bringen. Elektrolyseure zerlegen Wasser unter Einsatz von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff. Heute werden diese hauptsächlich noch in Handarbeit gefertigt. Eine Serienproduktion macht Elektrolyseure günstiger, schneller verfügbar und somit wettbewerbsfähig.
- H2Mare erforscht, wie Grüner Wasserstoff und andere Power-to-X-Produkte (Produkte, die aus Strom hergestellt werden) künftig in Offshore-Anlagen auf hoher See produzierbar sind. Dort steht viel Windkraft zur Verfügung, die eine direkte Produktion ohne Umwege über das Stromnetz ermöglicht.
- Weil Wasserstoff bei normalen Temperaturen und normalem Luftdruck ein viel höheres Volumen einnimmt als etwa Erdgas, sind auch der Transport und die Speicherung von Wasserstoff zentrale Forschungsthemen. Hier setzt das Projekt TransHyDE an: Es entwickelt und testet innovative Lösungen, zum Beispiel den Transport über bestehende
rund neuerGasleitungen, in Hochdruckbehältern oder in Verbindung mit anderen chemischen Stoffen.
Im Alltag kaum sichtbar, aber für die Gesellschaft hoch relevant
Grüner Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle in der Energiewende. Als sauberer Energieträger trägt er zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei und hilft, das Klima zu schützen und unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Zudem kann Grüner Wasserstoff fossile Energieträger in verschiedenen Anwendungen ersetzen, was langfristig zu geringeren Energiekosten führen kann. Nicht zuletzt fördert die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft Arbeitsplätze und Innovationen in Deutschland, was auch die Wirtschaft stärkt.
Konkrete Aufgabenstellungen für Jugendliche könnten sein:
“Baue eine Anlage, die Grünen Wasserstoff erzeugt. Zeige oder beschreibe, wo die Energie für die Erzeugung herkommt bzw. gewonnen wird. Wie löst du die aktuellen Probleme in deiner Welt durch den Einsatz des erzeugten Wasserstoffs? Beschreibe im Video oder durch Texttafeln, was Grünen Wasserstoff kennzeichnet und wie du das umsetzt.”
“Zeige Nutzungskonzepte für Wasserstoff. Wann ist der Einsatz von Grünem Wasserstoff in welchen Bereichen sinnvoll? Beschreibe im Video oder durch Texttafeln, warum es genau in den von dir ausgesuchten Bereichen sinnvoll ist und welche Schwierigkeiten es dabei noch gibt bzw. geben könnte.”
Geothermie nutzt die Wärme aus dem Erdinneren und ist eine klimafreundliche, erneuerbare Energiequelle, die unabhängig vom Wetter rund um die Uhr verfügbar ist. Vor allem die Tiefengeothermie hat großes Potenzial: Sie könnte in Zukunft bis zu ein Viertel des deutschen Wärmebedarfs decken. Dazu wird heißes Wasser aus tiefen Gesteinsschichten genutzt – entweder direkt aus vorhandenen Hohlräumen (hydrothermal) oder über künstlich geschaffene Wege (petrothermal). Bisher wird diese Technik noch wenig eingesetzt, doch das BMFTR fördert Forschungsprojekte, um Standorte besser zu erkunden, Risiken wie Erdbeben weiter zu minimieren und die Technik sicherer und wirtschaftlicher zu machen.
Geothermie ist eine Art, Wärme zu gewinnen, die gut für das Klima ist. Sie kommt aus der Erde, erneuert sich immer wieder und ist zuverlässig. Forschende sagen, dass wir mit Geothermie in Zukunft vielleicht ein Viertel unseres Wärmebedarfs in Deutschland decken könnten. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unterstützt Projekte, die das möglich machen sollen.
Wie funktioniert das?
Das Grundprinzip der Geothermie ist einfach: Wir nutzen die Wärme, die unter der Erdoberfläche gespeichert ist. Diese Wärme kommt von verschiedenen Dingen: Ein Teil ist Restwärme aus der Zeit, als die Erde entstanden ist. Der größere Teil entsteht durch natürliche, winzige Zerfälle in Gesteinen. Dieser Zerfall passiert ständig und sorgt dafür, dass immer wieder neue Wärme entsteht. Deshalb ist Geothermie eine wichtige erneuerbare Energiequelle.
Es gibt zwei Arten, die Erdwärme zu nutzen:
- Oberflächennahe Geothermie: Hier geht es nicht sehr tief in die Erde (bis etwa 400 Meter). Man nutzt zum Beispiel spezielle Kollektoren im Boden, Brunnen oder flache Sonden. Das ist besonders gut für einzelne Häuser. Größere Felder mit solchen Sonden können aber auch ganze Bürogebäude heizen. Auch tiefe Sonden und Bohrungen, die warmes Wasser liefern, gehören zu dieser Kategorie.
- Tiefengeothermie: Hier bohrt man tiefer als 400 Meter in die Erde.
Großes Potenzial für Deutschland
Je tiefer man in die Erde kommt, desto wärmer wird es. Im Durchschnitt wird es alle 100 Meter etwa 3 Grad wärmer. Weil es in der tieferen Erde so heiß ist, kann man mit Tiefengeothermie zuverlässig und immer Energie gewinnen. Man kann damit nicht nur heizen, sondern ab einer bestimmten Temperatur (etwa 120 Grad) auch Strom erzeugen. Außerdem kann man mit Tiefengeothermie Fernwärme erzeugen, was mit oberflächennaher Geothermie meist nicht geht.
Bei der hydrothermalen Tiefengeothermie wird heißes Wasser aus Hohlräumen und Spalten im Gestein nach oben gepumpt. Bei der petrothermalen Methode, die noch nicht so oft genutzt wird, muss man erst künstliche Wege für das Wasser im Gestein schaffen.
Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen und sicheren Nutzung
In einigen Gebieten in Deutschland wird Geothermie schon genutzt. Im Moment gibt es 42 Anlagen für Tiefengeothermie: 30 Heizwerke, zehn Heizkraftwerke (die Wärme und Strom erzeugen) und zwei reine Stromkraftwerke. Viele weitere Projekte sind geplant.
Die Forschung geht weiter: Es gibt noch technische Schwierigkeiten und finanzielle Risiken, die verhindern, dass Geothermie ihr volles Potenzial entfalten kann. Das BMFTR fördert deshalb Forschungsprojekte. Ziel ist es, neue Wärmequellen besser zu finden, ihr Potenzial zu bestimmen und die Nutzung sicher und dauerhaft zu machen. Zum Beispiel untersucht ein Projekt der Ruhr-Universität Bochum, wie Erdbeben entstehen können, die durch solche Anlagen ausgelöst werden. Ein anderes Projekt arbeitet an einer neuen Bohrtechnik, die das Risiko solcher Erdbeben verringern soll. Obwohl es in Deutschland bisher nur sehr selten kleine Erdbeben durch Geothermie gab und keine Schäden entstanden sind, ist es wichtig, das Risiko so gering wie möglich zu halten.
Eine Chance für die Zukunft
Im Moment kommt weniger als ein Prozent der erneuerbaren Wärme in Deutschland aus der Tiefengeothermie. Aber in Zukunft könnte sie einen wichtigen Beitrag zur Wärmeversorgung leisten – ohne dass wir von Kohle, Öl und Gas abhängig sind. Denn anders als bei Wind und Sonne ist Geothermie nicht vom Wetter abhängig. Ab etwa 20 Metern Tiefe ist die Temperatur in der Erde immer gleich und kann deshalb dauerhaft genutzt werden.
Die Geothermie ist eine klimaneutrale, erneuerbare und zuverlässige Form der Wärmeversorgung. Mit weiterer Forschung kann die Tiefengeothermie Studien zufolge in Zukunft ein Viertel des deutschen Wärmebedarfs decken. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) fördert entsprechende Vorhaben, um den Weg dahin zu ebnen.
Die Energie nutzen, die in Form von Wärme unter der Erdoberfläche gespeichert ist – das ist das Grundprinzip der Geothermie. Diese Erdwärme stammt aus verschiedenen Quellen. Etwa 30 bis 50 Prozent sind Restwärme aus den Prozessen während der Erdentstehung. 50 bis 70 Prozent gehen auf natürlichen, radioaktiven Zerfall in Gesteinen zurück. Dabei handelt es sich um einen andauernden Prozess, der für einen stetigen Nachschub an Wärme sorgt. Das macht die Geothermie zu einem wichtigen Baustein im Portfolio der erneuerbaren Energien.
Um sich die Erdwärme zunutze zu machen, gibt es zwei Möglichkeiten: die oberflächennahe Geothermie (bis 400 Meter Tiefe) und die Tiefengeothermie (ab 400 Meter Tiefe). In der ersten Kategorie kommen zum Beispiel Erdwärmekollektoren, Erdwärmebrunnensysteme und flache Erdwärmesonden zum Einsatz, insbesondere bei Eigenheimen. Sogenannte Erdwärmesondenfelder können zum Beispiel ganze Bürogebäude mit Wärme versorgen. Darüber hinaus zählen tiefe Erdwärmesonden und die Thermalwasserbohrung zu den oberflächennahen Verfahren.
Großes Potenzial für die Wärmeversorgung in Deutschland
Je tiefer es in die Erdkruste geht, desto wärmer wird es. Im Durchschnitt steigt die Temperatur mit zunehmender Tiefe um etwa 3 Grad Celsius/100 Meter. Aufgrund der höheren Temperaturen in der tieferen Erdkruste bietet die Tiefengeothermie die Möglichkeit zur zuverlässigen und konstanten Energiegewinnung – nicht nur für die Wärme-, sondern bei ausreichender Temperatur ab 120 Grad Celsius auch für die Stromversorgung. Außerdem eignet sie sich im Gegensatz zur oberflächennahen Geothermie für Fernwärme. Bei der hydrothermalen Tiefengeothermie wird dafür heißes Wasser aus Gesteinsporen und/oder Trennflächen zwischen Gesteinen gefördert. Für das petrothermale Verfahren, das aktuell noch selten zum Einsatz kommt, müssen Fließwege für Wasser geschaffen werden.
Auf dem Weg zur klimaneutralen und sicheren Geothermie
Die Geothermie wird bereits in verschiedenen Gebieten in Deutschland genutzt. Aktuell sind 42 Anlagen für Tiefengeothermie in Betrieb – 30 Heizwerke, zehn Heizkraftwerke für Wärme und Strom sowie zwei reine Stromkraftwerke. Zahlreiche weitere Projekte sind in Planung.
Auch in der Entwicklung geht es weiter voran: Technische Herausforderungen und wirtschaftliche Risiken sorgen aktuell noch dafür, dass die Geothermie nicht ihr volles Potenzial entfalten kann. Mit der Förderung von Forschungsvorhaben setzt sich das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) dafür ein, neue Wärmequellen besser zu lokalisieren, ihr Potenzial zu bestimmen sowie eine sichere und dauerhafte Nutzung durch Monitoringkonzepte zu ermöglichen. Beispielsweise behandelt das vom BMFTR unterstützte Projekt LISAGENS „Analyse der Interaktion von Störungsprozesszone und Spannungsfeld zur Identifikation des Agens induzierter Seismizität“ der Ruhr-Universität Bochum solche Fragen der Grundlagenforschung. Es ergänzt das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) geförderte Verbundvorhaben AGENS: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten in diesem Projekt daran, durch ein innovatives Verfahren mit einer Haupt- und mehreren Nebenbohrungen das Risiko für durch menschliche Aktivität verursachte Erdbeben deutlich zu reduzieren – auch wenn in Deutschland bislang nur selten entsprechende, auf Geothermieanlagen zurückzuführende Ereignisse registriert und keine Erdbebenschäden nachgewiesen wurden.
Eine Chance für die Energieversorgung von morgen
Aktuell speist sich in Deutschland weniger als ein Prozent der regenerativ erzeugten Wärme aus der Tiefengeothermie. In Zukunft kann sie aber einen entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung der Wärmeversorgung leisten – ohne von fossilen Brennstoffen abhängig zu sein. Denn anders als bei Wind- und Solarenergie ist sie nicht von wetterbedingten Schwankungen abhängig., Ab etwa 20 Metern Tiefe sind die Temperaturen in der Erdkruste konstant und deswegen dauerhaft nutzbar.
Eine konkrete Aufgabenstellung für Jugendliche zum Thema könnte sein:
“Baue eine Anlage, die Geothermie als Energiequelle nutzbar macht. Zeige welche Lücken im Energiesystem du mit Geothermie schließen kannst”.
Erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik sind zentral für ein klimafreundliches Energiesystem. Wind ist heute schon die wichtigste Stromquelle in Deutschland und der Anteil von Sonne und Wind soll bis 2030 stark wachsen. Damit das gelingt, fördert das BMFTR viele Forschungsprojekte – zum Beispiel zur Effizienzsteigerung bei Solarmodulen oder zur Doppelnutzung von Flächen durch Agri-Photovoltaik. Auch bei der Windkraft gibt es neue Ansätze, etwa Höhenwindräder und die Kombination mit Wasserstofferzeugung auf See. Forschung hilft, Ressourcen wie Seltene Erden zu sparen und den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen – für weniger CO₂ und mehr Klimaschutz.
Ein wichtiger Baustein für unsere Energieversorgung in der Zukunft ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Damit wir Kohle, Öl und Gas nach und nach ersetzen können, brauchen wir vor allem mehr Strom aus Wind und Sonne (Photovoltaik). Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unterstützt viele Forschungsprojekte zu erneuerbaren Energien.
Windkraft ist schon heute die wichtigste Quelle für Strom in Deutschland. Im Jahr 2024 wurde fast ein Drittel (31,5 Prozent) des Stroms mit Windkraft erzeugt. Photovoltaik lieferte im selben Jahr etwa 14 Prozent des Stroms. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien kommen. Dafür muss die Stromerzeugung aus Wind und Sonne ungefähr doppelt so groß werden wie heute.
Was können erneuerbare Energien?
Auch wenn Solaranlagen schon jetzt genutzt werden, gibt es noch viel zu forschen. Zum Beispiel, wie man Solarzellen noch besser machen kann oder wie man sie in besonderen Situationen einsetzen kann (z.B. auf Feldern, wo auch Landwirtschaft betrieben wird). Außerdem soll die Herstellung von Solarmodulen billiger werden und es soll besser funktionieren, alte Module zu recyceln.
Auch bei Windkraftanlagen hilft Forschung, sie besser, zuverlässiger und günstiger zu machen. Außerdem werden neue Wege gefunden, um Strom aus Windkraft zu gewinnen, zum Beispiel vor der Küste im Meer. Forschung ist sehr wichtig, damit wir die Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien erreichen können.
Forschung für bessere Solaranlagen
Damit Solaranlagen noch mehr Strom liefern können, fördert das BMFTR zum Beispiel das Forschungsprojekt „TEAM PV“. Ziel ist es, eine große internationale Gruppe zu gründen, die Solarmodule weiterentwickelt. Neue Arten von Solarzellen, die aus dem Mineral „Perowskit“ gemacht sind, könnten viel effizienter sein als die heute gebräuchlichen Solarzellen. Außerdem gibt es mit dieser neuen Technologie vielleicht wieder mehr Möglichkeiten, Solarzellen in Europa herzustellen.
Das BMFTR unterstützt auch Forschung, damit man Flächen besser nutzen kann, um erneuerbare Energien auszubauen. Agri-Photovoltaik (Agri-PV) bedeutet, dass man auf derselben Fläche gleichzeitig Lebensmittel anbaut und Strom erzeugt. Das Projekt SynAgri-PV untersucht, wie Agri-PV in Deutschland gut funktionieren kann. Andere Forschungsthemen zu Photovoltaik sind, wie man Solaranlagen leichter in Gebäude einbauen kann, wie man flexible Solarmodule herstellt und wie man alte Module besser recyceln kann.
Forschung für mehr Windkraft
Auch bei der Windkraft gibt es viele interessante Forschungsthemen: Ein Projekt, das vom BMFTR gefördert wird, entwickelt ein neues Windrad, das in großer Höhe funktioniert und so neue Standorte für die Stromerzeugung erschließt.
Windkraftanlagen brauchen viele Seltene Erden. Diese Rohstoffe sind begrenzt und ihre Gewinnung kann schlecht für die Umwelt sein. Deshalb sucht die Forschung nach Lösungen. Das Ziel des Projekts INSPIRE ist es, den Einsatz von Seltenen Erden zu verringern – auch bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff. Ein anderes Forschungsprojekt, H2Mare, das ebenfalls vom BMFTR gefördert wird, beschäftigt sich damit, wie man Windkraftanlagen auf See mit Anlagen zur Wasserstoffherstellung verbinden kann. Es wird erforscht, wie man Grünen Wasserstoff und andere Produkte, die mit Strom hergestellt werden (Power-to-X), direkt auf solchen Offshore-Anlagen produzieren kann.
Erneuerbare Energien schützen Klima und Umwelt
Dass der Anteil Erneuerbarer Energien am Strommix immer größer wird, ist nur mit Forschung möglich. Das ist gut für uns alle, denn Erneuerbare Energien ersetzen Kohle, Öl und Gas und sorgen so dafür, dass weniger schädliches CO₂ in die Luft gelangt. Das schützt unser Klima und unsere Umwelt.
Einer der Grundpfeiler für unser Energiesystem der Zukunft ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Um fossile Energieträger nach und nach ersetzen zu können, brauchen wir insbesondere mehr Strom aus Windkraft und Photovoltaik. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) fördert zahlreiche Forschungsvorhaben zu Erneuerbaren Energien.
Windkraft ist schon heute die wichtigste Energiequelle für die Stromversorgung in Deutschland. Ihr Anteil an der Stromerzeugung betrug im Jahr 2024 mit 31,5 Prozent fast ein Drittel. Photovoltaik (PV) lieferte im selben Jahr rund 14 Prozent des Stroms. Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien gedeckt und hierzu die Stromerzeugung durch Windkraft und PV ungefähr verdoppelt werden.
Potenziale der Erneuerbaren Energien
Obwohl PV-Anlagen bereits verbreitet im Einsatz sind, besteht weiterhin Bedarf an Forschung – beispielsweise zur Steigerung der Effizienz von Solarzellen oder zu speziellen Einsatzbedingungen (z. B. Agri-PV). Zudem stehen Kostensenkungspotenziale bei der Fertigung oder beim Recyceln von PV-Modulen im Fokus. Auch bei Windkraftanlagen verbessert Forschung die Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Zudem erschließen innovative Technologien neue Orte zur Gewinnung von Strom aus Windkraft, beispielsweise vor der Küste. Forschung trägt wesentlich dazu bei, die Ausbauziele der Erneuerbaren Energien zu erreichen.
Förderung der Forschung zu Photovoltaik
Um die PV-Leistung deutlich zu erhöhen, fördert das BMFTR unter anderem das Forschungsprojekt „TEAM PV“. Es hat zum Ziel, eine langfristige internationale Allianz zur Weiterentwicklung von Solarmodulen aufzubauen. Neuartige Solarzellen auf Basis von sogenannten „Perowskiten“ versprechen eine Steigerung der Effizienz, die auf anderem Wege nicht erreichbar wäre. Zudem steigen mit der neuen Technologie die Chancen, in Europa wieder vermehrt Solarzellen zu produzieren.
Daneben fördert das BMFTR auch Forschung für eine effizientere Flächennutzung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Agri-Photovoltaik (Agri-PV) bezeichnet die gleichzeitige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Produktion von Nahrungsmitteln und die Stromerzeugung. Das Projekt SynAgri-PV beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Etablierung von Agri-PV in Deutschland. Weitere aktuelle PV-Forschungsthemen sind die leichtere Integration in Gebäudestrukturen, flexible Solarmodule und das verbesserte Recycling von alten Modulen.
Förderung der Forschung zu Windkraft
In der Windkraft gibt es aktuell ebenfalls mehrere chancenreiche Forschungsthemen: Das von BMFTR und der Agentur für Sprunginnovationen (SPRIND) geförderte Höhenwindrad bringt ein neues Anlagenkonzept hervor, das weitere Standorte für die Energieerzeugung erschließt.
Windkraftanlagen haben einen hohen Bedarf an Seltenen Erden. Ihr Vorkommen ist beschränkt und deren Förderung kann mit negativen Umweltauswirkungen einhergehen. Hier sucht die Forschung nach Lösungen: Ziel des Projekts INSPIRE ist es, gleichzeitig auch den Einsatz von Seltenen Erden bei der Erzeugung von Grünem Wasserstoff zu verringern. Ein weiteres Forschungsprojekt, das sich ebenfalls der Kopplung von Windkraft mit Wasserstoff-Erzeugungsanlagen auf See widmet, ist das BMFTR-geförderte Wasserstoff-Leitprojekt H2Mare. Es erforscht, wie Grüner Wasserstoff und andere Power-to-X-Produkte (Produkte, die aus Strom hergestellt werden) künftig direkt in Offshore-Anlagen produzierbar sind.
Erneuerbare schützen Klima und Lebensgrundlagen
Der steigende Anteil Erneuerbarer Energien am Strommix ist nur mithilfe von Forschung erreichbar. Das kommt uns allen zugute, da Erneuerbare Energien fossile Energieträger ersetzen und damit CO2-Emissionen senken. Das schützt unser Klima und erhält unsere Lebensgrundlagen.
“Überlege dir, wie erneuerbare Energien im Energiesystem genutzt werden können. Überlege dir dabei auch, welche Lücken im System dabei entstehen können und wie diese geschlossen werden können.”
Batterien sind zentral für die Energiewende, da sie Strom speichern und viele Alltagsgeräte antreiben. Heute dominieren Lithium-Ionen-Batterien, doch sie nutzen knappe Rohstoffe und sind empfindlich. Die Forschung arbeitet deshalb an besseren, sichereren und umweltfreundlicheren Alternativen. Neue Batterien sollen länger halten, schneller laden und gut recycelbar sein. Besonders wichtig ist es, dabei auf seltene Rohstoffe zu verzichten. Der Staat fördert die Batterieforschung gezielt, etwa mit dem Projekt SoLiS zur Entwicklung von Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien. Ziel ist eine nachhaltige Batterieproduktion und mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung.
Gute Energiespeicher sind sehr wichtig für die Energiewende. Die Forschung an Batterien hilft uns, Technologien zu entwickeln, die Rohstoffe schonen und umweltfreundlich hergestellt werden. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) hat ein Programm gestartet, um diese Forschung gezielt zu unterstützen. Es heißt Dachkonzept Batterieforschung.
Die Batterien, die wir heute am häufigsten nutzen, sind Lithium-Ionen-Batterien. Wenn sie geladen sind, haben sie zwei Seiten: eine positive (Kathode) und eine negative (Anode). Dazwischen ist ein Elektrolyt, der kleine Teilchen (Ionen) leitet, und ein Separator, der die beiden Seiten voneinander trennt. Strom fließt erst, wenn man die beiden Seiten mit einem Kabel verbindet.
Obwohl Lithium-Ionen-Batterien meistens gut funktionieren, können sie empfindlich auf Kälte und Hitze reagieren. Außerdem verwenden diese Batterien einen flüssigen Elektrolyten, der zwar eine gute Ionenleitfähigkeit besitzt, aber leicht entflammbar ist und somit ein erhöhtes Brandrisiko darstellt. Dazu kommt, dass Lithium und andere Metalle, die für Batterien gebraucht werden, nur begrenzt vorhanden sind und durch andere Materialien mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit derzeit nicht vollumfänglich ersetzt werden können. Die Gewinnung dieser Rohstoffe ist oft schlecht für die Umwelt, da einerseits durch den Flächenabbau Lebensräume zerstört werden und andererseits Chemikalien in Boden, Wasser und Luft gelangen können.
Wie können wir Energie besser speichern?
Die Batterieforschung arbeitet genau daran: Die Forschenden entwickeln Energiespeicher, die leistungsfähiger, sicherer und umweltfreundlicher sind. Zum Beispiel sollen Elektroautos in Zukunft schneller laden und weiter fahren. Batterien sollen länger halten und so konstruiert sein, dass sich wertvolle Komponenten und Rohstoffe – wie Lithium, Nickel und Kobalt – am Ende der Lebensdauer effizient herauslösen, recyceln und in neuen Batterien wiederverwenden lassen. Außerdem ermöglichen bessere Batterien, noch mehr überschüssigen Strom aus Sonne und Wind zuverlässig zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Das macht unser Stromnetz stabiler und uns von Kohle, Öl und Gas weniger abhängig.
Gleichzeitig forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an neuen Technologien, die Post-Lithium-Technologien genannt werden. Diese Batterien sollen mit weniger kritischen Rohstoffen auskommen. So wird die Batterieproduktion langfristig umweltfreundlicher und auch günstiger.
Ohne Batterien geht es nicht in unserer modernen Welt
Batterien und Energiespeicher sind sehr wichtig für viele Dinge, die wir jeden Tag nutzen: Elektroautos, Smartphones, Herzschrittmacher, Hörgeräte, Spielzeug, Werkzeuge mit Akku, Roboter und Speicher für Solarstrom zu Hause. Die Batterie macht uns mobil, flexibel und unabhängig.
Jede dieser Anwendungen braucht aber eine Batterie, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wichtig sind zum Beispiel die Größe, die Form, wie lange sie hält und wie oft sie geladen und entladen wird. Hier ist die Batterieforschung gefragt: Die Batterie muss so gebaut sein, dass sie die speziellen Anforderungen erfüllt. Gleichzeitig muss jede Lösung möglichst umweltfreundlich sein.
Förderung für die Speichertechnologien der Zukunft
Ohne Batterien und ihre Weiterentwicklung können wir das Ziel nicht erreichen, klimaneutral zu werden. Klimaneutralität bedeutet, dass klimaschädliche Emissionen entweder ganz vermieden werden oder durch geeignete Gegenmaßnahmen ausgeglichen werden – zum Beispiel Nutzen von CO2 aus der Atmosphäre oder durch Anlegen neuer Wälder –. Deshalb unterstützt das BMFTR die deutsche Batterieforschung mit dem BMFTR-Dachkonzept Batterieforschung. Damit soll eine umweltfreundliche, wettbewerbsfähige und unabhängige Produktionskette für Batterien in Deutschland aufgebaut werden. Wichtige Forschungsziele sind die längere Haltbarkeit von Batterien, schnellere Ladezeiten und die Rückgewinnung der Rohstoffe aus alten Batterien. Diese Ziele sollen durch die Entwicklung von neuen Materialien, Bauteilen und Herstellungsverfahren sowie Recyclingtechnologien erreicht werden. Wichtige Hilfsmittel sind dabei die Digitalisierung und die Vergrößerung der Produktion. Das Programm richtet sich an Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Bundeseinrichtungen – zum Beispiel die Bundesanstalt für Materialforschung. Gefördert werden auch Forschungsverbünde aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie die nationale und internationale Zusammenarbeit.
Ein Beispiel aus dem Dachkonzept für zukünftige Batterietechnologien ist das Projekt SoLiS. Hier arbeiten Fachleute vom Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) daran, Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien für die Industrie zu entwickeln. Die Vorteile: Der Industrieabfall Schwefel ist billig, kann aber gleichzeitig sehr viel Energie speichern. Dadurch haben Lithium-Schwefel-Batterien mehr Energie als normale Lithium-Ionen-Batterien. Außerdem verwenden Festkörperbatterien einen festen Elektrolyten anstelle einer brennbaren Flüssigkeit – das verringert das Risiko von Bränden deutlich.
Das BMFTR hat mit der Förderung der Batterieforschung schon wichtige Grundlagen für eine umweltfreundliche und wettbewerbsfähige Energieversorgung in Deutschland und Europa geschaffen. So wurde eine große Forschungsstätte zum Aufbau der Batteriezelleproduktion in Deutschland aufgebaut: die Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB). Jetzt ist es wichtig, dass die neuen Entwicklungen auch in der Industrie angewendet und von uns allen im Alltag genutzt werden können. Dazu hat das BMFTR neben der FFB die Fördermaßnahme Batterie 2020 Transfer gestartet, sodass schon große Schritte in Richtung industrielle Umsetzung gemacht wurden.
Effiziente Energiespeicher sind ein zentraler Baustein der Energiewende. Die Batterieforschung treibt die Entwicklung ressourcenschonender Technologien und nachhaltiger Produktionsverfahren voran. Um diesen Fortschritt gezielt zu fördern, hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) das Dachkonzept Batterieforschung ins Leben gerufen.
Die derzeit gängigsten Energiespeicher sind Lithium-Ionen-Batterien. Im geladenen Zustand bestehen sie aus einem positiven und einem negativen Pol, der Kathode und der Anode. Dazwischen liegen der Elektrolyt, der Ionen leitet, und ein Separator, der die Pole trennt. Strom fließt erst, wenn die Pole durch ein Kabel miteinander verbunden sind.
Obwohl Lithium-Ionen-Batterien grundsätzlich zuverlässig sind, können sie empfindlich auf Kälte und Hitze sowie vollständiges Entladen oder Überladen reagieren. Außerdem arbeiten die flüssigen Elektrolyte dieser Batterien zwar schnell, sind aber auch relativ leicht entflammbar. Hinzu kommt, dass Lithium und andere für Batterien verwendete Metalle zu den begrenzt verfügbaren und schwer ersetzbaren Rohstoffen zählen, deren Gewinnung mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden ist.
Auf dem Weg zu einer zukunftsweisenden Energiespeicherung
Die Batterieforschung setzt genau hier an: Sie treibt die Entwicklung von Energiespeichern voran, die leistungsfähiger, sicherer und nachhaltiger sind. Dadurch können beispielsweise Elektrofahrzeuge in Zukunft mit kürzeren Ladezeiten größere Reichweiten erzielen. Künftige Batterien sind langlebiger und werden für innovative Recyclingprozesse konzipiert. Wertvolle Bestandteile und Rohstoffe – wie Lithium, Nickel und Kobalt – können zurückgewonnen werden und wieder in den Herstellungsprozess neuer Batterien einfließen. Zudem ermöglichen effizientere Batterien, überschüssige Energiegewinne aus Solar- und Windkraft zuverlässig zu speichern und bei Bedarf abzurufen, was die Stabilität des Stromnetzes erhöht und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert.
Gleichzeitig sorgt die Forschung an Post-Lithium-Technologien dafür, dass neue Batterien mit einer geringeren Menge an seltenen Rohstoffen auskommen. Das schont Ressourcen und verringert die Abhängigkeit von globalen Lieferketten, wodurch die Batterieproduktion langfristig nachhaltiger und auch wirtschaftlicher wird.
Ohne Batterien und Energiespeicher keine mobile Gesellschaft
Batterien und Energiespeicher sind essenzieller Bestandteil vieler alltäglicher Anwendungen: Elektroautos, Smartphones, Herzschrittmacher, Hörgeräte, Spielzeuge, Elektrowerkzeuge, Robotik und Heimspeicher sind nur einige Beispiele für das hohe Anwendungs- und Bedarfspotenzial. Batterien und Speicher ermöglichen Mobilität, Flexibilität und Unabhängigkeit.
Jede dieser Anwendungen bedarf jedoch einer gezielten Einstellung der Batterieeigenschaften, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Kriterien sind dabei beispielsweise die Größe, Geometrie, Einsatzdauer und Schaltfrequenz. Hier ist die Batterieforschung gefragt: Die Batterie muss so konzipiert sein, dass sie die individuellen Anforderungen erfüllt. Gleichzeitig muss jede Lösung nachhaltig und umweltschonend sein.
Förderung für die Speichertechnologien der Zukunft
Ohne Batterien und ihre Weiterentwicklung ist das Ziel der Klimaneutralität nicht zu erreichen. Deswegen unterstützt das BMFTR intensiv im Bereich der Batterieforschung. Zentrale Forschungsthemen sind eine längere Lebensdauer, kürzere Ladezeiten und die Rückgewinnung von Rohstoffen aus Batterien. Strategische Grundlage für die deutsche Batterieforschung ist das BMFTR-Dachkonzept Batterieforschung, mit dem eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und technologisch souveräne Batteriewertschöpfungskette aufgebaut werden soll. Es richtet sich an Forschungseinrichtungen, Unternehmen und öffentliche Institutionen. Schwerpunkte des Dachkonzepts liegen bei den Themen Material- und Komponentenentwicklung, Prozess- und Fertigungstechnik, Recycling und Kreislaufwirtschaft sowie Digitalisierung und Skalierungsforschung. Nationale wie internationale Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft werden gezielt ausgebaut und gefördert.
Ein Beispiel aus dem Dachkonzept für zukünftige Batterietechnologien ist das geförderte Projekt SoLiS. Dort arbeiten die Batterietechnikerinnen und -techniker des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS daran, Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien für die industrielle Anwendung zu entwickeln. Die Vorteile: Das Industrie-Abfallprodukt Schwefel ist kostengünstig und besitzt eine sehr hohe Speicherkapazität. Das Ergebnis ist eine höhere Energiedichte von Lithium-Schwefel-Batterien gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Zudem ersetzt bei solchen Festkörperbatterien ein feuerfester Festelektrolyt den entflammbaren Flüssigelektrolyt.
Das BMFTR hat mit der Förderung der Batterieforschung bereits wichtige Grundlagen für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Energieversorgung in Deutschland und Europa geschaffen. Jetzt gilt es, den Transfer in die Anwendung noch weiter voranzutreiben. Mit der Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) sowie der Fördermaßnahme Batterie 2020 (Transfer) sind bereits große Schritte in Richtung industrieller Umsetzung gemacht.
“Überlege dir, wie Strom in einem System gespeichert werden kann und welche Technologien du einsetzen kannst, um den Strom im System zu halten.”